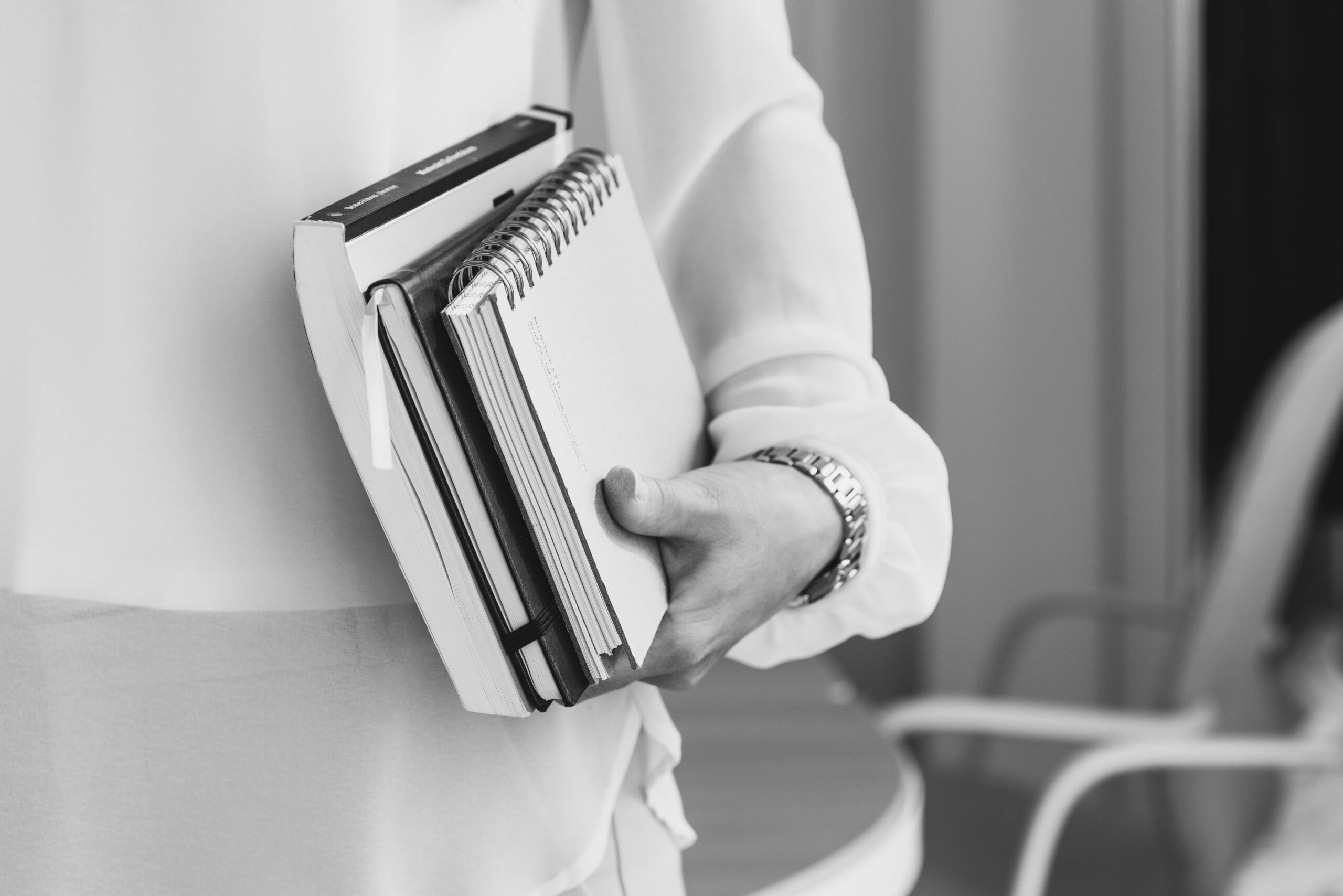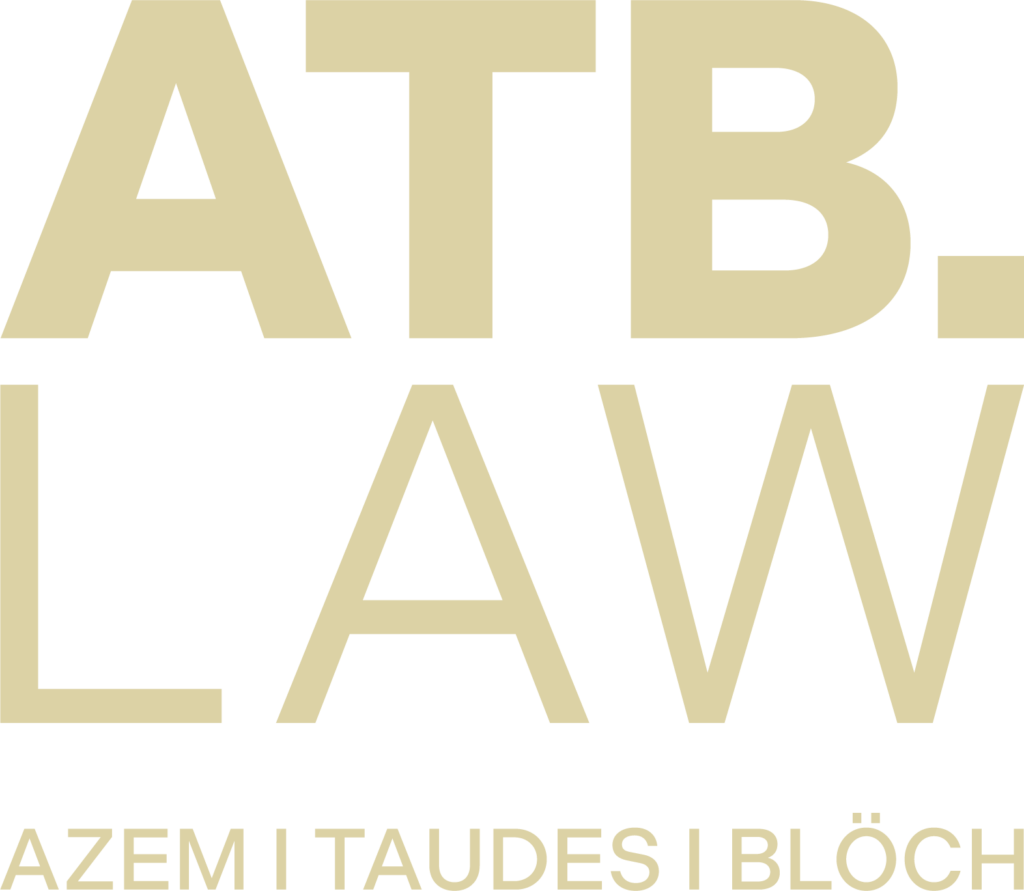Was ist eine Lebensgemeinschaft?
Die Anzahl der (nichtehelichen) Lebensgemeinschaften nimmt kontinuierlich zu und damit steigt auch deren Bedeutung stetig an. Durch den Anstieg der Zahl der Lebensgemeinschaften und der damit verbundenen Zunahme des gemeinsamen Wohnens von Lebensgefährten in unterschiedlichsten Ausgestaltungen, entstehen diverse wohnrechtliche Fragestellungen.
Die nichteheliche Lebensgemeinschaft gleicht der Ehe nach ihrem äußeren Erscheinungsbild und dem zugrundeliegenden Lebenssachverhalt weitestgehend, unterscheidet sich von der Ehe aber durch die Möglichkeit der jederzeitigen Auflösung. Von einer Lebensgemeinschaft ist bei Vorliegen eines auf Dauer angelegten eheähnlichen Zusammenlebens in einer Wohn-, Wirtschafts-, und Geschlechtsgemeinschaft auszugehen, wobei nicht sämtliche Merkmale stets vorliegen müssen. Mangels Vorliegens einer allgemein gültigen gesetzlichen Definition der Lebensgemeinschaft oder des Lebensgefährten, ist stets kontextbezogen zu prüfen, wer im konkreten Fall als Lebensgefährte anzusehen ist.
Warum ist die vertragliche Vorsorge wichtig?
Im Gegensatz zu den gesetzlich detailliert geregelten Rechtsverhältnissen zwischen Ehegatten, welche auch im Bereich des Wohnrechts ausgeprägt sind, enthält das Gesetz nur sehr geringe Vorgaben zur Regelung der wohnrechtlichen Verhältnisse zwischen Lebensgefährten. Es bleibt daher den Lebensgefährten weitgehend selbst überlassen, eine vorausschauende Planung ihrer wohnrechtlichen Verhältnisse vorzunehmen und besonders für den Fall der Trennung ausreichende und rechtzeitige Vorsorge zu treffen. Ein taugliches Instrument hierfür wären Partnerschaftsverträge, welche allerdings in der Praxis in Österreich – gemessen an der Zahl der bestehenden Lebensgemeinschaften – derzeit nicht weit verbreitet sind.
Eine Vielzahl der Lebensgefährten verlässt sich daher auch bei der Regelung ihrer wohnrechtlichen Beziehungen auf die allgemeinen zivilrechtlichen Regeln und verabsäumt eine einzelfallbezogene Planung der wohnrechtlichen Verhältnisse mit Vorausschau auf die Folgen einer allfälligen Auflösung der Lebensgemeinschaft. Ohne vertragliche Vorsorge kann im Fall der Trennung von Lebensgefährten zur Vermögensaufteilung nur auf allgemeine zivilrechtliche Regelungen zurückgegriffen werden.
Wohnrechtliche Position des „aufgenommenen Lebensgefährten“
Die jeweilige Rechtsstellung des Lebensgefährten im Bereich des Wohnrechts variiert stark, je nach der gewählten Form des Zusammenlebens. Aus der bloßen Aufnahme einer Lebensgemeinschaft entsteht kein Wohnrecht, es könnte daher der Lebensgefährte, der Eigentümer oder Mieter der Wohnung ist, welche die Lebensgefährten gemeinsam bewohnen – jedenfalls nach Aufhebung der Lebensgemeinschaft – grundsätzlich jederzeit die Räumung der Wohnung verlangen und besteht für einen „aufgenommenen Lebensgefährten“ ohne einen von der Lebensgemeinschaft unabhängigen Rechtstitel kein Schutz davor, der Wohnung verwiesen zu werden.
Zur Schaffung eines Rechtstitels des zugezogenen Lebensgefährten scheint insbesondere die Untermiete denkbar und praktikabel. Durch den Abschluss eines Untermietvertrages zwischen den Lebensgefährten erhält der zugezogene Lebensgefährte Rechtsbesitz am Mietobjekt und steht ihm damit das Recht zur Erhebung einer Besitzstörungsklage – etwa im Fall des plötzlichen unzugänglich Machens des Objekts durch den alleinigen Hauptmieter – zu. Gleichzeitig verbleibt dem alleinigen Hauptmieter das Recht auf Kündigung des Untermietverhältnisses im Fall einer Auflösung der Lebensgemeinschaft und besteht somit ein gewisser Interessenausgleich.
Miete vs. Eigentum – über Problemstellungen und vertragliche Lösungen
Lebensgefährten, die gemeinsame Hauptmieter einer Wohnung sind, können vor dem Problem stehen, dass sie ohne Zustimmung des anderen Lebensgefährten und Zustimmung des Vermieters nicht ohne weiteres das Mietverhältnis beenden können. Es sollte deshalb in einem Partnerschaftsvertrag zumindest eine Regelung im Innenverhältnis darüber getroffen werden, wer im Trennungsfall in der Wohnung verbleibt und im Innenverhältnis für den Mietzins aufkommt.
Auch für Lebensgefährten, die Wohnungseigentümerpartner sind, empfiehlt es sich, eine partnerschaftsvertragliche Regelung hinsichtlich der Rechtsfolgen der Auflösung der Lebensgemeinschaft zu treffen, da die Beendigung der Lebensgemeinschaft per se keinerlei Auswirkung auf das Fortbestehen der Wohnungseigentümerpartnerschaft hat. So wäre etwa vertraglich zu regeln, ob einer der Lebensgefährten künftig Alleineigentümer werden soll, oder ob das Wohnungseigentumsobjekt im Trennungsfall veräußert werden soll. Auch die Höhe des zu leistenden Kaufpreises für den Mindestanteil des anderen Lebensgefährten bzw der Aufteilungsschlüssel betreffend den Verkaufserlös im Fall einer Veräußerung des Wohnungseigentumsobjekts sollte vertraglich fixiert werden. Für den Zeitraum des Bestehens der Lebensgemeinschaft kann partnerschaftsvertragliche Vorsorge getroffen werden, indem beispielsweise die Aufhebungsklage für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen wird. Auch für den Todesfall eines Eigentümerpartners kann vertragliche Vorsorge getroffen werden.
Lebensgefährten, die schlichte Miteigentümer einer Liegenschaft (samt Haus) sind, sind ebenso darauf angewiesen, privatautonome Regelungen einer Auflösung der Lebensgemeinschaft zu treffen. So besteht insbesondere Regelungsbedarf über die genauen Modalitäten der Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft und bedarf es zum Beispiel einer Festlegung, wem, für welchen Zeitraum ein Weiterbenutzungsrecht zukommen soll.
Fazit
Die Gestaltung der wechselseitigen wohnrechtlichen Rechtsverhältnisse obliegt den jeweiligen Lebensgefährten. Durch vorausschauende vertragliche Vorsorge, die auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche sowie die konkrete Wohnsituation der Lebensgefährten abgestimmt ist, können Rechtsstreitigkeiten (insbesondere für den Fall einer Trennung) vermieden werden.
Im Zusammenhang mit der Errichtung von Partnerschaftsverträgen und der Beratung von Lebensgefährten zur Gestaltung ihrer wohnrechtlichen Beziehungen, stehen Ihnen Alexandra Rech und Daniel Azem jederzeit unter office@atb.law bzw. telefonisch unter 01 39 12345 zur Verfügung.